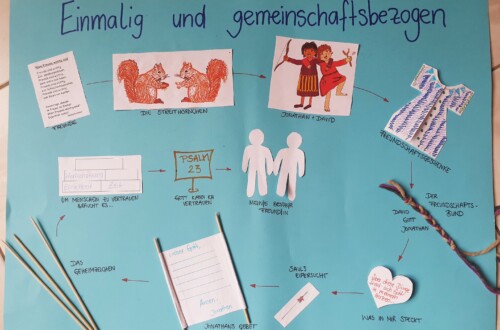Zwischen Beruf und Berufung
Die Identität der Religionslehrkraft im schulischen Kontext. Von Thorsten Kneuer.
„Wer bin ich als Religionslehrkraft?“ Diese Frage begleitet viele von uns durch das Schuljahr – manchmal im Moment der Begeisterung, wenn der Unterricht besonders gelingt, manchmal im Zweifel, wenn unser Fach wieder einmal hinter anderen zurücksteht. Religionslehrkraft zu sein ist mehr als ein Beruf. Es ist ein Rollenbild voller Facetten, Erwartungen, Möglichkeiten – und nicht zuletzt eine persönliche Berufung.
Im Rahmen der Jahresfortbildung 2025 für Religionslehrkräfte im Bistum Würzburg stand diese Frage im Zentrum: „Wer bin ich als Religionslehrkraft?“ Der Vortrag, der diesen Impuls gab, stellte drei zentrale Perspektiven in den Mittelpunkt: Wer soll ich sein? – Wer will ich sein? – Wer kann ich sein? Drei Zugänge, die helfen können, die eigene Rolle im Spannungsfeld von System, Schule und Selbstverständnis neu zu betrachten.
1. Wer soll ich sein? – Die Rolle im System Schule
Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Sie ist ein sozialer Raum, in dem junge Menschen lernen, leben und sich selbst entdecken. Und mittendrin: der Religionsunterricht – ein Fach, das mehr ist als ein Fach. Hier geht es in erster Linie nicht um Wissen und Wissensvermittlung, sondern um Sinn, um Werte, um Welt- und Menschenbilder.
Religionslehrkräfte bewegen sich in einem vielschichtigen Erwartungsdreieck:
- Die Kirche sieht sie als Glaubenszeug*innen und Vermittler*innen christlicher Tradition.
- Die Schule nimmt sie als Fachlehrkräfte wahr – oft mit einem Sonderstatus, da sie nicht im staatlichen Schuldienst verankert sind.
- Die Schüler*innen wiederum wünschen sich keine dogmatische Belehrung, sondern ehrliche Gespräche, Orientierungshilfen und authentische Persönlichkeiten, die mit ihnen auf Augenhöhe nachdenken und fragen.
Diese verschiedenen Zuschreibungen führen nicht selten zu einem inneren Spannungsfeld. Wie gelingt es, den Ansprüchen der Institution Kirche gerecht zu werden, ohne sich instrumentalisieren zu lassen? Wie kann ich als Lehrkraft meinen Platz im Kollegium behaupten, wenn mein Fach als gerade mal „nice to have“ belächelt wird? Und wie bleibe ich offen, glaubwürdig und echt gegenüber den Jugendlichen, die oft sehr feine Antennen für Unechtheit haben?
Doch genau hier liegt auch die Chance: Die eigene Rolle nicht nur zu erfüllen, sondern aktiv zu gestalten – aus einem Bewusstsein heraus, das sowohl professionalisiert als auch persönlich verankert ist. Die Identi- tät der Religionslehrkraft entsteht im Spannungsfeld dieser Rollen – sie ist nie statisch, sondern ein dynamischer Aushandlungsprozess.
Wer soll ich also sein? Vielleicht eine, die mitten im System steht – aber nicht mit ihm verschmilzt. Einer, der Strukturen kennt – und sie auch kritisch hinterfragt. Eine Stimme für das Andere, das Nicht-Selbstverständliche. Jemand, die*der durch die eigene Haltung zeigt: Glauben ist nicht naiv, sondern eine Form von Tiefsinn, von Widerstand gegen das Oberflächliche.
2. Wer will ich sein? –Mein Platz in der Schulfamilie

Religionsunterricht geschieht nie im luftleeren Raum. Religionslehrkräfte sind Teil einer Schulgemeinschaft – und wie sie diesen Platz gestalten, prägt auch ihre Wirksamkeit.
Wie präsent sind wir im Schulalltag? Wie gestalten wir Beziehungen im Kollegium, in der Klassengemeinschaft, im Dialog mit Eltern?
Es macht einen Unterschied, ob ich als Randfigur auftauche – oder als integriertes Mitglied der „Schulfamilie“. Wer mitgestaltet, mitdenkt und mitträgt, gewinnt nicht nur Einfluss, sondern auch Resonanz. Denn Glaubwürdigkeit entsteht nicht allein durch Worte, sondern vor allem durch Haltungen, durch Präsenz, durch den langen Atem im Alltag.
Die Frage ist also nicht nur: Wie werden wir wahrgenommen? Sondern auch: Wie möchten wir wahrgenommen werden? Als Fach am Rand – oder als Herzstück von Bildung, das den ganzen Menschen in den Blick nimmt? Als isolierte Einzelkämpfer*innen – oder als verlässliche Stimmen im pädagogischen Miteinander?
Engagement in der Schulkultur ist kein Selbstzweck. Es ist Ausdruck einer Haltung. Wenn wir etwa Schulgottesdienste kreativ gestalten, interreligiöse Projekte anstoßen oder im Klassenrat Haltung zeigen, setzen wir Zeichen. Wenn wir auch in schwierigen Gesprächen im Lehrer*innenzimmer den Ton der Hoffnung nicht verlieren, prägen wir Atmosphäre. Wenn wir sichtbar sind – als Ansprechpersonen, als Mitfühlende, als Impulsgeber*innen – entsteht eine Resonanz, die weit über das eigene Fach hinausreicht.
Religionslehrkräfte können „Salz der Erde“ sein – nicht laut und schrill, aber wirkkräftig und spürbar.
3. Wer kann ich sein? –Zwischen Erwartungen und Möglichkeiten
Die Realität ist herausfordernd. Viele von uns erleben einen schulischen Alltag, in dem Religion zunehmend an den Rand gedrängt wird – durch Lehrpläne, durch Zeitdruck, durch ein säkulares oder plural geprägtes Umfeld. Der Religionsunterricht muss sich rechtfertigen: Warum überhaupt noch Religion? Und warum konfessionell?
Und doch: In diesem vermeintlich engen Raum steckt Potenzial. Gerade dort, wo Religion nicht mehr selbstverständlich ist, öffnen sich Räume für echte Fragen: Was trägt mich? Worauf kann ich vertrauen? Was gibt meinem Leben Sinn?
Religionslehrkräfte können diese Räume gestalten – nicht als Besserwisser*innen, sondern als Resonanzgeber*innen, die den leisen Tönen Gehör verschaffen; als Brückenbauer*innen, die Glauben und Gegenwart miteinander ins Gespräch bringen; als Systembrecher*innen, die anders denken dürfen – und sollen.
Dabei geht es nicht um fertige Antworten, sondern um das Ermöglichen guter Fragen. Vielleicht ist das sogar das Beste, was wir tun können: Räume schaffen, in denen junge Menschen nicht funktionieren müssen, sondern fragen dürfen. In denen Unsicherheit erlaubt ist. In denen die Frage nach G*tt nicht peinlich, sondern kostbar ist.
Gerade in dieser Offenheit liegt eine Stärke. Religionslehrkräfte können eine Atmosphäre ermöglichen, in der die große Frage „Was zählt wirklich?“ Platz hat – und in der die Antwort nicht vorgegeben, sondern gesucht, geteilt und vielleicht auch gefunden wird.
4. Die eigene Rolle bewusst gestalten

Religionslehrkraft zu sein, heißt nicht nur, ein Fach zu unterrichten. Es heißt, Menschen zu begleiten – mit Kompetenz, mit Haltung, mit Herz. Es heißt auch, sich selbst immer wieder neu zu befragen: Wer bin ich? Und wer werde ich gerade?
In einer Zeit, in der Bildungswelten sich rasant verändern, in der religiöse Sozialisation schwindet und gesellschaftliche Debatten schärfer werden, braucht es Persönlichkeiten, die nicht alles mitmachen, sondern innehalten. Die nicht resignieren, sondern inspiriert bleiben. Die wissen, dass sie nicht alles retten müssen – aber viel bewirken können.
Gerade in Zeiten des Wandels ist es wichtig, das eigene Selbstverständnis zu reflektieren: Nicht nur zu fragen: Was wird von mir erwartet? Sondern auch: Was ist mir wichtig? Was bringe ich mit? Wo kann ich Wirkung entfalten?
Der Religionsunterricht lebt von Persönlichkeiten, nicht von Standardrollen. Er lebt von Menschen, die mit Ecken und Kanten, mit Zweifel und Begeisterung, mit Fachwissen und Glaubensoffenheit präsent sind.
Sich als Religionslehrkraft immer wieder neu zu verorten, ist kein Zeichen von Schwäche – sondern Ausdruck einer gelebten Professionalität. Denn Identität ist nie fertig. Sie ist ein Weg – vielleicht sogar: ein Pilgerweg. Und auf diesem Weg dürfen auch wir fragen, hoffen, scheitern und glauben.
Wer bin ich – als Religionslehrkraft?
Diese Frage lässt sich vielleicht nie endgültig beantworten. Aber sie lohnt es, immer wieder gestellt zu werden. Denn in der Suche nach einer Antwort liegt die Kraft zur Erneuerung – und vielleicht auch ein Stück Berufung.