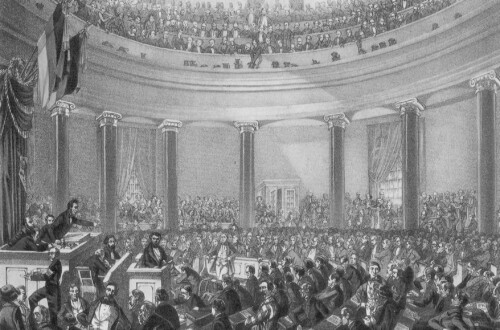Achtsamkeit üben im Religionsunterricht – und auch darüber hinaus
In Resonanz mit sich und mit anderen. Von Alexandra Andersen.
Wenn Schüler*innen am Ende einer Achtsamkeitsübung sagen: „Das war die erste Minute heute, in der ich einfach mal ich selbst sein durfte“, dann wird spürbar, warum Achtsamkeit weit mehr ist als eine Methode. Sie ist ein Weg, in Verbindung zu treten – mit sich selbst, mit anderen, mit dem Leben. Gerade im Religionsunterricht, wo große Fragen nach Sinn, Gemeinschaft und Menschsein gestellt werden, ist Achtsamkeit nicht nur relevant, sondern elementar. Insbesondere die Einübung einer achtsamen Grundhaltung ist eine wichtige Basis für eine gelingende schulpastorale Arbeit, die das Wohlbefinden und die Entwicklung von Schüler*innen in den Mittelpunkt stellt.
Ich selbst war 25 Jahre Lehrerin an einem Gymnasium in Würzburg. 2017 habe ich dort das Fach „Lernen mit Achtsamkeit“ eingeführt – zunächst als zartes Pflänzchen, später als fest etabliertes Fach. Heute ar- beite ich freiberuflich als Trainerin für Achtsamkeit, gewaltfreie Kommunikation und emotionale Intelligenz und bilde Lehrkräfte in Bildungseinrichtungen und Führungskräfte in Unternehmen in diesen Berei- chen weiter. Zusätzlich wirke ich in unterschiedlichen Projekten mit, wie z. B. bei WISE UP – ein Erasmus- Projekt, bei dem es um einen bewussten Umgang mit digitalen Medien im Schulkontext durch Achtsamkeit geht. Ich habe außerdem mehrere Bücher veröffent- licht, in denen es um Achtsamkeit im Schulalltag geht. Achtsamkeit ist für mich nicht nur ein Thema, sondern eine Haltung, die getragen ist von Präsenz, Mitgefühl, Authentizität und Bewusstheit.
Gerade im Religionsunterricht, der oft als einer der wenigen Fächer Räume für Stille, persönliche Reflexion und existenzielle Fragen bietet, kann Achtsamkeit eine Brücke schlagen – zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen Kopf und Herz. Sie fördert nicht nur Selbstwahrnehmung, sondern auch Resonanzfähigkeit, die Fähigkeit, sich berühren zu lassen – und damit letztlich auch Spiritualität im weitesten Sinne. Indem wir Achtsamkeitsübungen in den Stundenablauf integrieren, schaffen wir einen geschützten Raum, in dem Schüler*innen ihre eigenen Werte klären und den Wert der Gemeinschaft neu entdecken können.
1. Warum Achtsamkeit in der Schule und gerade im Religionsunterricht?

Achtsamkeit bedeutet, mit wacher, nicht wertender Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment zu sein. Es ist ein Innehalten inmitten der Beschleunigung, ein bewusster Schritt aus dem Autopiloten heraus. Für Schüler*innen (und ebenso für Lehrkräfte) kann sie ein kraftvoller Schlüssel sein, um innere Ruhe zu finden, Emotionen zu regulieren, Empathie zu entwickeln und die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken.
Gerade im Religionsunterricht, der oft als einer der wenigen Fächer Räume für Stille, persönliche Reflexion und existenzielle Fragen bietet, kann Achtsamkeit eine Brücke schlagen – zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen Kopf und Herz. Sie fördert nicht nur Selbstwahrnehmung, sondern auch Resonanzfähigkeit, die Fähigkeit, sich berühren zu lassen – und damit letztlich auch Spiritualität im weitesten Sinne. Indem wir Achtsamkeitsübungen in den Stundenablauf integrieren, schaffen wir einen geschützten Raum, in dem Schüler*innen ihre eigenen Werte klären und den Wert der Gemeinschaft neu entdecken können.
2. Die Quellen der Achtsamkeit
Auch wenn der Begriff „Achtsamkeit“ in der heutigen Bildungspraxis oft modern-psychologisch daherkommt, hat er tiefe Wurzeln:
- Buddhistische Tradition: In der buddhistischen Lehre ist „sati“ – das achtsame Gewahrsein – ein zentraler Bestandteil des Achtfachen Pfades. Dieses Gewahrsein ist nicht passiv, sondern fordert aktive Aufmerksamkeit und Mitgefühl.
- Moderne Stressforschung: Jon Kabat-Zinn hat das Konzept in den 1970er-Jahren entmystifiziert und in ein weltlich-humanistisches Format überführt. Seine MBSR-Programme (Mindfulness-Based Stress Reduction) zeigen eindrücklich, wie wirksam Achtsamkeit im Alltag sein kann.
- Religiöse Praxis: Auch im Christentum, Judentum, Islam und anderen Weltreligionen gibt es Praktiken, die achtsames Dasein kultivieren – sei es kontemplatives Gebet, Stille, Gottesdienste oder Rituale. Achtsamkeit verbindet somit Welten: die spirituellen und die säkularen, die inneren und die äußeren, die individuellen und die gemeinschaftlichen.
3. Wirkungen, die wirken
Zahlreiche Studien belegen mittlerweile die positiven Effekte von Achtsamkeit – auf Konzentration, Stresserleben, Emotionsregulation und Sozialverhalten. Doch ihre Wirkung zeigt sich oft noch direkter im Alltag:
- Stressreduktion und Entspannung: Kinder, die lernen, ihren Atem als Anker zu nutzen, um sich zu beruhigen, erleben weniger Schulangst und Prüfungsstress.
- Emotionale Intelligenz: Jugendliche, die Gefühle wahrnehmen, benennen und ausdrücken lernen, reagieren weniger impulsiv und können Konflikte konstruktiver lösen.
- Empathie und Gemeinschaft: Klassen, in denen durch regelmäßige Achtsamkeitspraxis ein Klima der Zugewandtheit entsteht, verzeichnen weniger Mobbing und mehr gegenseitige Unterstützung.
- Lehrer*innen-Wohlbefinden: Lehrkräfte, die regel- mäßig üben, finden Zugang zu ihrer inneren Kraft – nicht durch „noch mehr Tun“, sondern durch acht- sames Sein, und verhindern so Burnout.
Wenn Sie daran interessiert sind und in Bezug auf den Forschungsstand zur Achtsamkeit aktuell sein wollen, schauen Sie sich gern auf der Homepage des MBSR- Verbands um. Dort finden Sie stets die aktuellen Studien und Informationen.
4. Achtsamkeit im Religionsunterricht – konkrete Möglichkeiten
Damit Achtsamkeit nicht als eine Worthülse stehen bleibt, ist es sinnvoll, sie in den Kontext religiöser und ethischer Themen einzubetten. Hier einige Ideen, die sich flexibel in Grundschule, Sekundarstufe I und II einsetzen lassen:
Atem beobachten – in der Stille ankommen
(ab Klasse 1 | 1–5 Min)
Die Schüler*innen sitzen im Stuhlkreis oder auf dem Boden, schließen die Augen (optional) und legen eine Hand sanft auf den Bauch. Sie folgen dem Atemzug und beobachten, wie sich der Bauch hebt und senkt. Dabei kann es hilfreich sein, die Atemzüge zu zählen, um noch mehr beim Atem zu bleiben. (Für eine genaue Anleitung: A. Andersen, Achtsamkeitsübungen für die Sekundarstufe, Verlag a.d. Ruhr, 2024)
Zuhören mit dem Herzen
(ab Klasse 3 | 10–15 Min)
Partnerarbeit: Schüler*innen erzählen eine Minute lang etwas Persönliches (z. B. ihr Lieblingsbuch oder ein Erlebnis). Die Zuhörenden verzichten auf Rückfragen und Kommentare und schenken vollkommene Präsenz. Danach Rollen tauschen. Reflexion: Wie hat sich echtes Zuhören angefühlt?
Bewegung und Achtsamkeit: Der achtsame Gang
(ab Klasse 3 | 10 Min)
Die Klasse läuft langsam durch den Raum oder einen vorbereiteten Parcours im Freien. Jeder Schritt wird bewusst wahrgenommen: „Wie fühlt sich der Boden unter meinem Schuh an?“ Diese Übung wirkt wie ein „Reset“ im hektischen Schulalltag. (Für eine genaue Anleitung: A. Andersen, Achtsamkeitsübungen für die Sekundarstufe, Verlag a.d. Ruhr, 2024)
Dankbarkeit kultivieren
(ab Klasse 1 | 10 Min)
Laden Sie die Schüler*innen stets am Ende der Woche ein, innezuhalten und einen dankbaren Blick auf die vergangenen Tage zu werfen. Jede Person notiert, wofür sie dankbar ist, und lässt auch die anderen daran teilhaben. Dies kann mündlich oder als eine Art Meditation erfolgen. Motivieren Sie die Schüler*innen, auch ein Dankbarkeitstagebuch für sich selbst zu führen – denn die Wirksamkeit ist inzwischen ebenfalls wissenschaftlich erforscht und hat einen großen Benefit für das Leben.
5. Achtsamkeit ist mehr als eine Methode – sie ist eine Haltung
Im schulischen Kontext wird Achtsamkeit oft als „Tool“ vermittelt. Doch sie entfaltet ihre tiefste Wirkung dann, wenn sie nicht nur gelehrt, sondern gelebt wird. Wenn Lehrkräfte selbst regelmäßig üben, wenn sie nicht sofort reagieren, sondern einen Atemzug dazwischen legen. Wenn sie bereit sind, sich selbst liebevoll zu begegnen – auch an schwierigen Tagen.
Lehrkräfte fungieren dabei als Vorbilder: Durch ihre eigene Praxis zeigen sie, wie man in herausfordernden Situationen ruhig bleibt, sich selbst freundlich begegnet und empathisch reagiert. Ein achtsamer Unterricht beginnt nicht erst mit der ersten Übung, sondern mit einer Haltung – in jedem Wort, in jedem Blick, in jeder Pause.
Denn Achtsamkeit beginnt bei uns selbst. Erst wenn wir in Resonanz mit unserem eigenen Inneren treten, können wir in authentischer Beziehung zu anderen sein. Genau hier wird sie zur Brücke – nicht nur im Religionsunterricht, sondern im ganzen Leben.
6. Verknüpfung mit religionspädagogischen Themen
Achtsamkeit eröffnet im Religionsunterricht vielfältige Berührungspunkte:

- Stille und Gebet: Achtsamkeitsübungen können als moderne Form kontemplativer Praxis erlebt werden. Es geht im Grunde genommen darum mitzukriegen, was in uns lebendig ist. Der Atem, den alle Menschen in sich tragen, der uns am Leben erhält und der unser Menschsein ausmacht, kann zu jeder Zeit beobachtet werden und uns als Anker dienen. Im christlichen Schöpfungsmythos erscheint der Atem als von Gott gegeben – warum ihn also nicht beobachten und mit ihm in Stille sitzen: staunend, demütig und dankbar!
- Mitgefühl und Nächstenliebe: Eine Selbstmitgefühls-Meditation (auch Metta genannt) knüpft direkt an christliche Traditionen von Liebe und Barmherzigkeit an. Gerade in der heutigen Welt, in der Gewalt und Konflikte an der Tagesordnung sind und uns vielleicht auch ohnmächtig und ratlos machen, ist es wichtig, immer wieder bei uns selbst zu beginnen. Denn es heißt: Liebe deinen Nächste WIE DICH SELBST (Mt 22,37–39). Dies können wir durch eine aktive Selbstmitgefühlspraxis üben und Kindern und Jugendlichen somit eine Bewusstheit für ihre Wirksamkeit ermöglichen – für eine friedvollere Welt, die in unserer inneren Welt beginnt!
- Gemeinschaftserfahrungen: Gemeinsames Üben stärkt das Gruppengefühl und fördert das Bewusstsein für die Verbundenheit aller Stille und Meditation mit mehreren Menschen zu praktizieren, hat eine ganz eigene Wirkung, die deutlich spürbar ist, wenn sie immer mehr in den (Schul-)Alltag Einzug findet. Nicht umsonst kennen wir im Christentum den Satz: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,19–20).
7. Ein persönlicher Ausblick
Ich erlebe in meiner Arbeit mit Lehrkräften, wie groß das Bedürfnis nach echter Begegnung, nach Stille und nach innerer Balance ist. Viele haben den Wunsch, in ihrer Arbeit wieder mehr Sinn, Tiefe und Lebendigkeit zu erleben. Achtsamkeit kann genau das ermöglichen – nicht als fertige Lösung, sondern als Einladung, den eigenen Weg bewusster zu gehen.
In meiner Rolle in der Lehrplankommission für das neue Fach „Life Skills“ darf ich miterleben, wie diese Themen langsam Einzug in die Bildungslandschaft halten. Ich bin überzeugt: Achtsamkeit im Unterricht ist kein Luxus. Sie ist eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit.
Und sie beginnt – genau jetzt, mit diesem nächsten Atemzug.
Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute für Ihre Arbeit als Lehrer*in – ein Beruf, der sich in einem großen Wandel befindet und sich wahrscheinlich ganz neu erfinden darf. Denn wenn wir unsere nachfolgenden Generationen zukunftsorientiert, sicher und ehrlich begleiten wollen, dann braucht es Authentizität, ein großes Bewusstsein und eine achtsame innere Haltung der Lehrkraft. Dann nehmen wir die Zeichen der Zeit ernst, begegnen Schüler*innen auf Augenhöhe und haben die eigenen Ressourcen im Blick – für mentale und körperliche Gesundheit!
Seien Sie sich gut und kultivieren Sie Ihre eigene Achtsamkeit!
Literatur
- Andersen, A. 2020, Achtsamkeit im Unterricht – Konzentration, Entspannung und Wahrnehmung trainieren: Buch mit Kopiervorlagen und Audio-Material, Cornelsen-Verlag.
- Andersen, A. 2024, Achtsamkeitsübungen für die Sekundarstufe: Stress abbauen, Emotionen regulieren, Konzentration fördern, Verlag a.d. Ruhr.
- Andersen, A. 2024, Wie viele Tabs haben Sie gerade geöffnet?, in: didacta, Das Magazin für lebenslanges Lernen 1/24, Special: Lehrergesundheit, S. 46–48.
- Andersen, A. 2025, Hand aufs Herz – Spielerische Achtsamkeitsübungen für Grundschulkinder: Resilienz stärken, Gefühle regulieren, Stress abbauen. Verlag a.d. Ruhr.
- Andersen, A. 2025, Achtsamkeit üben im Schulalltag, in: Schulmagazin 5-10, Impulse für kreativen Unterricht, 1/2 | S. 36–41.