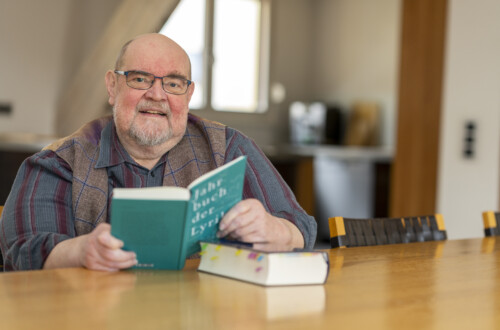Bibel mit Herz und Verstand
Mit „Lectio Divina“ die Bibel heute entdecken. Von Ursula Silber.
-
Dem Wort auf der Spur
„Kann man eigentlich auch die Bibel lesen, ohne vorher Theologie studiert zu haben?“, so fragen mich mitunter Menschen. Natürlich! Schließlich wurde die Bibel ja auch für ganz normale Menschen geschrieben; sie will gelesen werden, sie ist ein offenes, ein gesprächiges Buch, das eine Begegnung zwischen Lesenden und Text möglich macht, wünscht, sogar fordert.
Manchmal frage ich mich aber: „Kann man die Bibel lesen, auch wenn man vorher Theologie studiert hat?“ Mein theologisch ausgebildetes Gehirn analysiert literarkritisch, kanonisch oder auch sozialgeschichtlich – aber erreicht das Wort mein Herz? Geht beides zusammen – Bibel lesen mit Herz und Hirn, analytisch und betend, exegetisch verantwortet und spirituell? Nur so kann die Bibel doch zur „heiligen“ Schrift werden, die Relevanz besitzt für mein Leben. Mit dem Lectio-Divina-Leseprojekt des Katholischen Bibelwerks hat sich für mich ein Weg eröffnet, wirklich „dem Wort auf der Spur“ zu sein. Unter diesem Titel hat das Katholische Bibelwerk seit 2010 Begleitmaterialien herausgegeben, mit denen jeweils ein „Leseprojekt“ (zu einem Thema oder einem biblischen Buch) durchgeführt werden kann.

Dabei ist „Lectio Divina“ nicht einfach eine neue Methode (unter vielen anderen), sondern eine Grundhaltung, die Bibel zu lesen. Und zwar mit Herz und Hirn! Dazu hilft ein einfacher Ablauf in mehreren Schritten:
-
-
- Lesen („Lectio“)
- Nachdenken („Meditatio“)
- im Gebet antworten („Oratio“)
- Staunen und Verweilen („Contemplatio“).
-
Vier Schritte – das ist überschaubar und leicht einzuüben. Es geht darum, einfach die Bibel zu lesen, dem Wort unmittelbar und direkt zu begegnen, und auch mir selbst. Vor allem der erste Schritt, das „Lesen“, ist zentral; denn hier geht es darum, den Text erst einmal wahrzunehmen. Strukturen, Schlüsselwörter, Bewegungen oder Interaktionen lassen sich bereits mit ein- fachen Impulsen entdecken. Ganz ohne Kommentar, nur mit dem eigenen, aufmerksamen Hinschauen.
Erst nachdem ich auf diese Weise in den Text eingetaucht bin, kommt im zweiten Schritt auch mein eigenes Leben mit ins Spiel: Was sagt der Text mir? Gibt es eine Resonanz in meinem eigenen Leben, vielleicht einen Trost oder auch einen Anstoß, mich in Bewegung zu setzen und etwas zu tun? Für die Antwort im Gebet gibt es viele Möglichkeiten, ob allein oder in der Gruppe: mit Worten oder ganz still, mit einem Lied oder mit bunten Stiften. Auch das Tun der Barmherzigkeit kann ein Gebet sein.
Dabei ist die „Lectio Divina“ nichts Neues. Auf der Suche nach einer Les-Art der Bibel, die sowohl spirituell als auch intellektuell verantwortet ist, nimmt sie mich mit auf eine Zeitreise bis zu den Kirchenvätern (und -müttern). Beim Kirchenvater Origenes (in einem Brief 238 n. Chr.) liegen die Wurzeln der „Lectio Divina“ als einer Haltung, die das Lesen und Studieren der Bibel als Gebet, als Gespräch mit Gott versteht und einübt. Später wurde es in vielen Klöstern gute Gewohnheit, täglich eine feste Zeit für die spirituelle Bibel-Lesung zu reservieren; und nicht umsonst war es ein Kartäuser namens Guigo, der im 12. Jahrhundert die oben bereits erwähnten Schritte dieses Gesprächs-Prozesses als Sprossen einer „Himmelsleiter“ formulierte. Noch später war es zumindest in der katholischen Welt nicht mehr vorgesehen, dass Laien selbstständig in der Bibel lesen und dabei gar mit Gott ins Gespräch kommen sollten. Das änderte sich erst wieder im 20. Jahrhundert; und an der Schwelle zum 21. Jahrhundert regen die Päpstliche Bibelkommission (1993) sowie die Bibelsynode (2008) an, die „lectio divina“ wieder stärker zu fördern. Aber ehrlich gesagt – klingt das nicht alles eher verstaubt und sehr amtskirchlich? Kirchenväter, Kartäuser und Kardinäle – sieht so die „Bibel für mich“ aus, die mich anspricht und die mit meinem Leben zu tun hat?

Ja, die „Lectio divina“ ist eine „vormoderne“ Art, die Bibel zu lesen. Als sie entstand, waren manche Voraussetzungen (noch) selbstverständlich: Zum Beispiel die Annahme, dass die Schrift einen Sinn besitzt (sogar einen mehrfachen). Die Grundoption beim Lesen der Schrift war, mit Gott in Kontakt zu kommen. Studium und Gebet, Gelehrsamkeit und Gottesnähe waren für die Mütter und Väter der Lectio Divina noch unvermischt und ungetrennt. Mit ihren Wurzeln, die bis in die Patristik zurückreichen, ist die „Lectio Divina“ eben auch ökumenisch – ein Schatz, der allen Konfessionen gehört. Dieses Potential könnte man auch heute nutzen, um in ganz unterschiedlichen Milieus und Kulturen gemeinsam oder individuell die Bibel zu lesen.
Damit zeigt sich bereits: „Lectio Divina“ ist anschlussfähig an moderne und postmoderne Fragen, Themen und Konzepte. Und eben auch für „ganz normale“ Menschen, die ohne Vorkenntnisse und manchmal auch ohne kirchlich-religiöse Sozialisation die Bibel lesen. Die alte Weisheit „Die Schrift wächst mit den Lesenden“ (Gregor von Nyssa) kehrt im modernen Gewand der Rezeptionsästhetik wieder. Der Sinn der Schrift ist nicht einfach „da“, sondern er entsteht immer neu beim Lesen. Durch und in den Menschen, die lesen – und dabei ihre Vorerfahrungen, ihre Sehnsüchte und Träume, ihre Fragen und Zweifel und auch ihr Vor-Wissen mit in den Prozess einspeisen. Herz und Hirn eben.
Ganz bewusst bezieht daher das „Lectio Divina“- Leseprojekt des Bibelwerks den „state of the art“ der exegetischen Wissenschaft mit ein und stellt sich da- mit in den Kontext einer biblisch-theologischen Kultur. Exegese und „Lectio Divina“ haben vor allem eines gemeinsam: Sie lesen den Text genau, achtsam und aufmerksam, mit Zeit und mit Blick fürs Detail. Beiden geht es darum, vor allem den Text der Schrift sprechen zu lassen, ohne sich selbst in den Vordergrund zu spielen. Letztlich geht es um ein verantwortetes, reflektiertes Lesen. Genau darin liegt die große Chance der Methode, sei es beim persönlichen Lesen oder beim Schriftgespräch in einer Gruppe. Dabei wird auch das private Bibel-Lesen immer eingebettet in die „ekklesia“ der Suchenden und Glaubenden, in die lebendige Tradition der Kirche(n) und in ihre Gegenwart.
Kann das etwas bewirken? Wirklich aufmerksam und beharrlich die Schrift zu lesen, verändert Menschen und damit auch die Gemeinschaft, in der sie ihren Glauben miteinander leben. Es verändert Sichtweisen, die innere Einstellung und vielleicht sogar die Ziele. Weil es mit Gott in Kontakt bringt, der leisen Stimme Gottes Gehör verschafft und unumkehrbar Herz und Hirn verwandelt. Diese verändernde Kraft, von der die Bibel selbst schon weiß (vgl. z. B. Jes 55, 10f und Hebr 4, 12), lässt sich allerdings weder kontrollieren noch instrumentalisieren. Sie entwickelt ihre eigene Dynamik. Gott sei Dank!
-
Lectio Divina in religionspädagogischen Kontexten
Lectio Divina ist ein Lernweg, eine Erkundungsreise, ein forschendes Lesen. Lectio Divina setzt Bibel und Leben in Beziehung zueinander. Insofern handelt es sich um einen Weg, der gut kompatibel ist mit religionspädagogischen Grundhaltungen und Konzepten. Zugleich lebt diese Methode von der intrinsischen Motivation, etwas entdecken zu wollen, sowie von der Überzeugung, dass beim Bibellesen „Gott mit am Tisch“ sitzt. Im Arbeitsfeld Religionsunterricht sehe ich aus drei Gründen eher Zurückhaltung geboten:
Lectio Divina ist prozessorientiert und ergebnisoffen!
Der Kontext „Schule“ ist von Abfragen, Prüfen und Beurteilen geprägt. Lernen wird organisiert, überprüft, gemessen. Dieser „Kontrakt“ prägt Lehrende und Lernende gleichermaßen. Kann es in diesem Setting wirklich bewertungsfreie Räume geben? Diese Frage muss behutsam und ehrlich beantwortet werden, damit die Lectio Divina sich entfalten kann. Die „Leseschlüssel“ der ersten Runde verstehen sich als Impulse, bei denen es nicht um „richtig“ oder „falsch“, nicht einmal um die vollständige Bearbeitung aller Fragen geht; sie lenken allenfalls den Blick in eine Richtung, in der man – vielleicht – etwas entdecken kann. Der zweite „Leseschlüssel“ verbindet das Gelesene mit dem eigenen Leben, der eigenen Erfahrung. Das sind ggf. sensible Themen, die einen geschützten Raum benötigen, der von Akzeptanz und Wertschätzung geprägt ist und gerade nicht urteilt und bewertet.
Deshalb: Wer Lernziele erreichen will (oder muss), sollte dies nicht auf dem Weg der Lectio Divina versuchen. Ganz schlecht (aber leider immer wieder praktiziert) ist auch die „Ergebnissicherung“ durch eine Zusammenfassung durch die Lehrkraft!
Lectio Divina braucht Zeit!
Der Schulalltag ist getaktet: Gleich wird das Pausenzeichen zu hören sein, dann sind die Schüler:innen (in einem bestimmten Alter zumindest …) nicht mehr zu halten. Oder es klingelt, und die nächste Lehrkraft mit einer komplett anderen Materie wartet schon. Aus der Lectio Divina mal eben in den Mathe-Unterricht hüpfen (oder umgekehrt) – das ist nicht einfach! Und gleiches gilt ja auch für die Lehrkraft. 45 Minuten sind wenig Zeit, um wirklich entdecken, nachdenken und staunen zu können. Vom „Nachschmecken“ und Nachklingen-Lassen mal ganz abgesehen…
Diese Problematik gilt natürlich für die meisten Kontexte, ob es die tägliche klösterliche „Lesezeit“ ist oder ein Bibelabend in der Gemeinde. Immer wird die Leitung gefragt sein, den Zeitrahmen und die Gruppe gut einschätzen und behutsam führen zu können.
Lectio Divina ist betendes Lesen!

Wie bereits gesagt, versteht sich Lectio Divina weniger als Methode denn als Beziehungsgeschehen, bei dem ausdrücklich Gott mit am Tisch sitzt. Man könnte auch sagen: als betendes Lesen. Oder gar als kleinformatige Wort-Gottes-Liturgie. Im staatlichen Unterricht kann ich nicht voraussetzen, nicht erwarten und nicht verlangen, dass Schüler:innen an Gott glauben und sich darauf einlassen, selbst wenn sie den konfessionellen Religionsunterricht besuchen. In Bayern gibt es die Möglichkeit des „Schulgebetes“ (BaySchO 2016 §27) – aber die staatliche Schule ist grundsätzlich ein Ort der Achtung vor der Glaubens-Freiheit. Man darf, muss aber nicht beten. Für mich persönlich wäre das ein Ausschlusskriterium, im Unterricht eine Lectio Divina durchzuführen.
Möglichkeiten in der Schule
Dennoch bietet auch die Schule durchaus Räume, in denen Lectio Divina gut ihren Platz hat und eine Möglichkeit bietet, die Bibel für sich zu entdecken und mit Leben und Glauben in Beziehung zu setzen. Diese Möglichkeiten sehe ich allerdings eher im Bereich der Schulpastoral. Freie Gottesdienst-Formen wie Frühschichten, aber auch Schulanfangs- oder Schuljahresabschluss-Gottesdienste (sofern sie in überschaubaren Gruppen stattfinden) bieten ein anderes „Framing“ und laden eher dazu ein, sich persönlich auf die Begegnung mit Gottes Wort einzulassen. Ebenso eignen sich „Tage der Orientierung“ gut für die Lectio Divina als eine Form spiritueller Impulse und Vertiefungen. Um nicht durch den schwierigen lateinischen Begriff „Lectio Divina“ unnötige Hürden oder gar Widerstände hervorzurufen, bietet sich eine andere Bezeichnung an: „Dem Wort auf der Spur“, „Bibel mit Herz und Verstand“, „4 Schritte mit der Bibel“, „Himmelsleiter-Lesen“… oder was auch immer Interesse und Lust zum Ausprobieren wecken kann!
Mit jüngeren Kindern im Grundschulalter kann man die Grundstruktur Lectio Divina sichern, muss aber deutlich elementarisieren:
-
-
- Textzuschnitt und Übersetzung sorgfältig auswählen
- mit einem Ritual in den „Ruhe-Modus“ hineinführen
- den Text vorlesen oder erzählen, evtl. visualisieren (Symbole, Biblische Erzählfiguren…)
- jeweils nur einen Leseschlüssel für beide Lese-Richtungen anbieten; ggf. kann man auf die Stillarbeit verzichten und eher in einem behutsamen Gespräch gemeinsam den Fragen nachgehen
- altersgemäße Anleitung zur „Contemplatio“ – es kann, muss aber nicht Stille sein! Vielleicht ist kreatives Gestalten, Bewegung oder ein (bekanntes) Lied eine angemessene Form der Vertiefung und des Staunens.
-
Möglich ist auch, in der Sekundarstufe die Lectio Divina (wie auch andere erfahrungsorientiert und/ oder spirituelle Formen) als „Selbstversuch“ durchzuführen. Dann könnte die Fragestellung lauten: Welche verantworteten Wege gibt es, um Wissen und Glauben zusammenwirken zu lassen? Welche Grundlagen und Voraussetzungen haben sie? Wie funktionieren sie? Lern-Ziel wäre in diesem Fall aber weniger das Entdecken der Resonanzen im eigenen Leben und der Dialog.
Gut geeignet ist die Lectio Divina für viele religionspädagogische Handlungsfelder mit Erwachsenen, zum Beispiel in der begleitenden Elternarbeit im Rahmen der Erstkommunionkatechese. Für viele mag es eine ganz neue Erfahrung sein, sich Zeit zu nehmen und eine Atempause zu gönnen, selbst zu fragen und zu entdecken, den Resonanzen im eigenen Leben nachzugehen – und all das mit einem Bibeltext! Auch mit Multiplikator:innen wie Erzieher:innen und Lehrkräften kann diese Form, sich mit Bibeltexten zu beschäftigen, neue Zugänge eröffnen.
Immer gilt: Lectio Divina soll etwas aufschließen helfen – dafür gibt es Regeln und einen gut strukturierten Weg, den aber jede:r Einzelne selbst und in aller Freiheit gehen muss. Daher beinhaltet die Leitungsverantwortung auch, Lectio Divina nicht zu verzwecken. Das einzige Ziel sollte sein, die Bibel allgemein oder einen besonderen Bibeltext für sich zu entdecken und „lieben zu lernen“.
Material:
Kostenloses Info- und Arbeitsmaterial des Bistums Würzburg
Lectio-Divina-Projekt des Katholischen Bibelwerks
Lectio-Divina: Leseblatt zur Emmausgeschichte