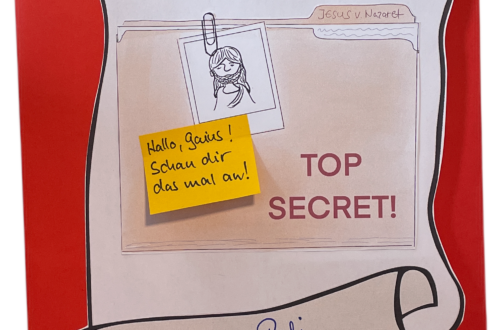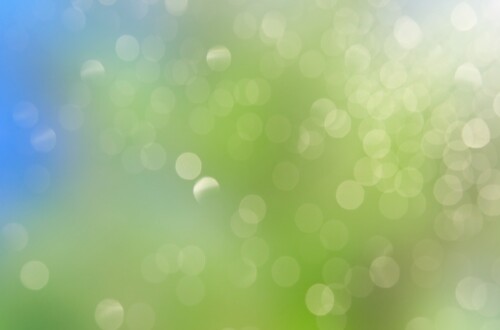Schule als Lebens- und Lernort der Demokratie: Die Verfassungsviertelstunde in der religiösen Bildung
Eine Perspektivenanalyse aus dem Religionsunterricht. Von Havva Doksar und Christian Back.

Die Einführung der Verfassungsviertelstunde durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus stellt ein deutliches Signal zur Stärkung der Demokratiebildung am Lernort Schule dar. Als integraler Bestandteil des Gesamtkonzeptes politischer Bildung hat dieses Format das primäre Ziel, demokratische Werte nicht nur zu vermitteln, sondern sie im schulischen Alltag erlebbar zu machen. Wöchentlich sollen Schülerinnen und Schüler systematisch mit den Grundwerten des Grundgesetzes sowie der Bayerischen Verfassung vertraut gemacht und zugleich in ihrer Fähigkeit gestärkt werden, die freiheitlich-demokratische Grundordnung kritisch zu reflektieren und in ihrem Lebensumfeld zu verorten.
Dabei versteht sich die Verfassungsviertelstunde nicht als starres Konzept, sondern als offenes, flexibel adaptierbares Unterrichtsprinzip. Sie eröffnet vielseitige pädagogische Zugänge und lässt sich an aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen anschließen. Im Fokus stehen zentrale verfassungsrechtliche Werte, die sowohl rechtlich fundiert als auch ethisch begründet sind, um Orientierung zu geben und verantwortungsbewusstes Handeln zu fördern. In diesem Zusammenhang formuliert das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus drei wesentliche Zielsetzungen:
- Die Sensibilisierung für die Relevanz verfassungsmäßiger Werte für das individuelle Leben und das gesellschaftliche Zusammenleben.
- Die Förderung demokratischer Grundhaltungen wie Toleranz, Gemeinsinn und Perspektivenübernahme.
- Der Beitrag zur Entwicklung und Pflege einer lebendigen Verfassungskultur.
Die Implementierung der Verfassungsviertelstunde in allen Fächern und Schularten setzt eine verantwortungsvolle Mitwirkung auch des Religionsunterrichts voraus. Aus fachdidaktischer Sicht eröffnen sich hierbei vielfältige Anknüpfungspunkte, die sich bereits in den curricularen Vorgaben des Fachs widerspiegeln. Insbesondere die thematische Auseinandersetzung mit anthropologischen, ethischen und gesellschaftlichen Fragestellungen ermöglicht eine substanzielle Verbindung zu den Zielen der Verfassungsviertelstunde.
Religiöse Bildung als wertvolle Ressource für die Förderung von Demokratiebildung
Für den Religionsunterricht stellt die Verfassungsviertelstunde in diesem Kontext nicht lediglich ein Instrument zur Vermittlung von Wissen über die Verfassung dar. Vielmehr eröffnet sie durch die Möglichkeit, politische und religiöse Bildung miteinander zu verknüpfen, einen bedeutsamen Lernraum für Persönlichkeitsbildung und selbstbestimmte gesellschaftliche Partizipation.
Der Religionsunterricht kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung einer reflektierten und wertebasierten demokratischen Grundhaltung leisten. Dies lässt sich nicht zuletzt darauf zurückführen, dass zahlreiche verfassungsrechtliche Leitbegriffe ihren Ausdruck in zentralen ethisch-religiösen Traditionen finden. In der Verbindung von politischer Bildung und religiöser Werteerziehung entsteht somit ein fruchtbarer Bildungsraum, in dem sowohl politische Mün- digkeit als auch ethische Orientierung gleichermaßen nachhaltig gefördert werden.
Hierbei lassen sich sieben zentrale Perspektiven für die Umsetzung der Verfassungsviertelstunde im Religionsunterricht beispielhaft benennen:
- Menschenwürde: Sowohl im Grundgesetz (Art. 1 GG) als auch in der biblischen Schöpfungstheologie (Gen 1,27) wird jedem Menschen ein unantastbarer Wert
- Gewissenfreiheit: Die Freiheit des Gewissens (Art. 4 GG) stellt ein sowohl religiös als auch politisch bedeutsames Prinzip dar. Biblische Gestalten – etwa die Propheten – handeln auf der Grundlage eines überzeugten Gewissens.
- Solidarität: Das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 GG) korrespondiert beispielsweise mit dem biblischen Gebot der Nächstenliebe (Lev 19,18), dem Gleichnis des barmherzigen Samariters (Lk 10,25–37) oder der Enzyklika Fratelli tui von Papst Franziskus.
- Gleichstellung: Die rechtlich garantierte Gleichberechtigung (Art. 3 GG) steht im Spannungsfeld zwischen normativer Vorgabe sowie kirchlicher Praxis und bietet Anlass zur kritischen Auseinandersetzung.
- Frieden: Frieden ist ein zentrales Leitmotiv religiöser Traditionen (vgl. B. Mt 5,9) und zugleich ein erklärtes Staatsziel (Präambel GG, Art. 1 BV).
- Religionsfreiheit: Zwischen Bekenntnis und Distanz eröffnet die Religionsfreiheit (Art. 4 GG, 107 BV) einen Raum für religiöse Toleranz, wie sie auch im interreligiösen Dialog reflektiert wird.
- Schöpfungsverantwortung: Der Umweltschutz (Art. 20a GG, 141 BV) ist Teil des Schöpfungsauftrages (vgl. Gen 1) und bietet Anknüpfungspunkte für eine Ethik ökologischer Verantwortung und Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt die Enzyklika Laudato si‘ von Papst Franziskus bietet hier eine Möglichkeit, das Thema aufzugreifen.Bezogen auf die dargestellten Perspektiven eröffnet die Verfassungsviertelstunde im Religionsunterricht somit einen gezielten und wirkungsvollen Rahmen, um zentrale Werte und Prinzipien nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern sie im schulischen Alltag erfahrbar und handlungsleitend werden zu lassen. Auf diese Weise entsteht ein reflexiver Bildungsraum, in dem Schülerinnen und Schüler ihre ethisch-politische Haltung kritisch hinterfragen, bewusst gestalten und kommunikativ vertreten können. Dies ist ein wesentlicher Schritt zur Förderung wertegeleiteter demokratischen Mündigkeit und zur Stärkung demokratischer Resilienz.

Bild: Adobe Stock Religiöse Bildung im Spannungsfeld demokratiepädagogischer Anforderungen
Für die erfolgreiche Verankerung demokratiepädagogischer Ziele im Religionsunterricht ist es unerlässlich, die Verfassungsviertelstunde nicht als bloße thematische Ergänzung zu begreifen. Stattdessen bedarf es einer systematisch durchdachten Integration, die durch inhaltliche Tiefenschärfe, theoretische Fundierung und diskursive Komplexität gekennzeichnet ist.
Eine grundlegende Voraussetzung stellt die curriculare Verankerung auf der Basis didaktischer Reflexionsfähigkeit dar, ebenso wie die enge interdisziplinäre Kooperation zwischen Expertinnen und Experten der politischen und religiösen Bildung. Unter solchen Bedingungen kann die Verfassungsviertelstunde dazu beitragen, über reine Wissensvermittlung hinauszugehen und die Entwicklung personaler, sozialer und politischer Handlungskompetenz zu unterstützen.
Vor diesem Hintergrund kommt den Lehrkräften eine Schlüsselrolle zu, da die Qualität der Umsetzung maßgeblich von deren professioneller Haltung, didaktischer Expertise und fachdidaktischem Selbstverständnis abhängt. Eine bloße curriculare Festschreibung demokratiepädagogischer Inhalte ist dabei nicht ausreichend. Vielmehr ist eine gezielte Befähigung und Ermutigung der Lehrpersonen erforderlich, anspruchsvolle Themen fundiert und wirkungsvoll im Unterricht zu realisieren.
Gleichzeitig existieren in der Praxis mitunter Vorbehalte, die unter anderem aus Befürchtungen resultieren, das eigene Fachprofil könnte durch eine zu starke politische Ausrichtung verwässert werden oder die spezifischen Anforderungen politischer Bildung würden nicht adäquat berücksichtigt. Solche Bedenken sind keineswegs marginal, sondern spiegeln ein berechtigtes Bedürfnis nach fachlicher Kohärenz, Rollensicherheit und professioneller Orientierung wider. Lehrerprofessionalität umfasst daher nicht nur vertiefte Fachkompetenz, sondern auch die Fähigkeit, interdisziplinäre Perspektiven konstruktiv zu integrieren und in strukturierte, bildungswirksame Lernprozesse zu überführen.
Um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen, ist eine differenzierte und systematisch angelegte Unterstützung der Lehrkräfte auf allen institutionellen Ebenen erforderlich. Hierzu zählen eine integrative Lehrerbildung, die religions- und politikdidaktische Komponenten verzahnt, zielgerichtete Fortbildungsformate, kollegiale Austauschmöglichkeiten sowie didaktisch fundiertes Unterrichtsmaterial. Zudem bedarf es einer schulischen Kultur, die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert und Demokratiebildung strukturell verankert.
Besonders, wenn Lehrkräfte als professionelle Gestalterinnen und Gestalter demokratischer Bildungsprozesse nachhaltig gestärkt werden, kann die Verfassungsviertelstunde ihr volles Potenzial entfalten und einen bedeutenden Beitrag zur politischen Mündigkeit der Lernenden leisten – insbesondere im Religionsunterricht, der sich hierbei als unverzichtbare Ressource für die Demokratiebildung erweist.