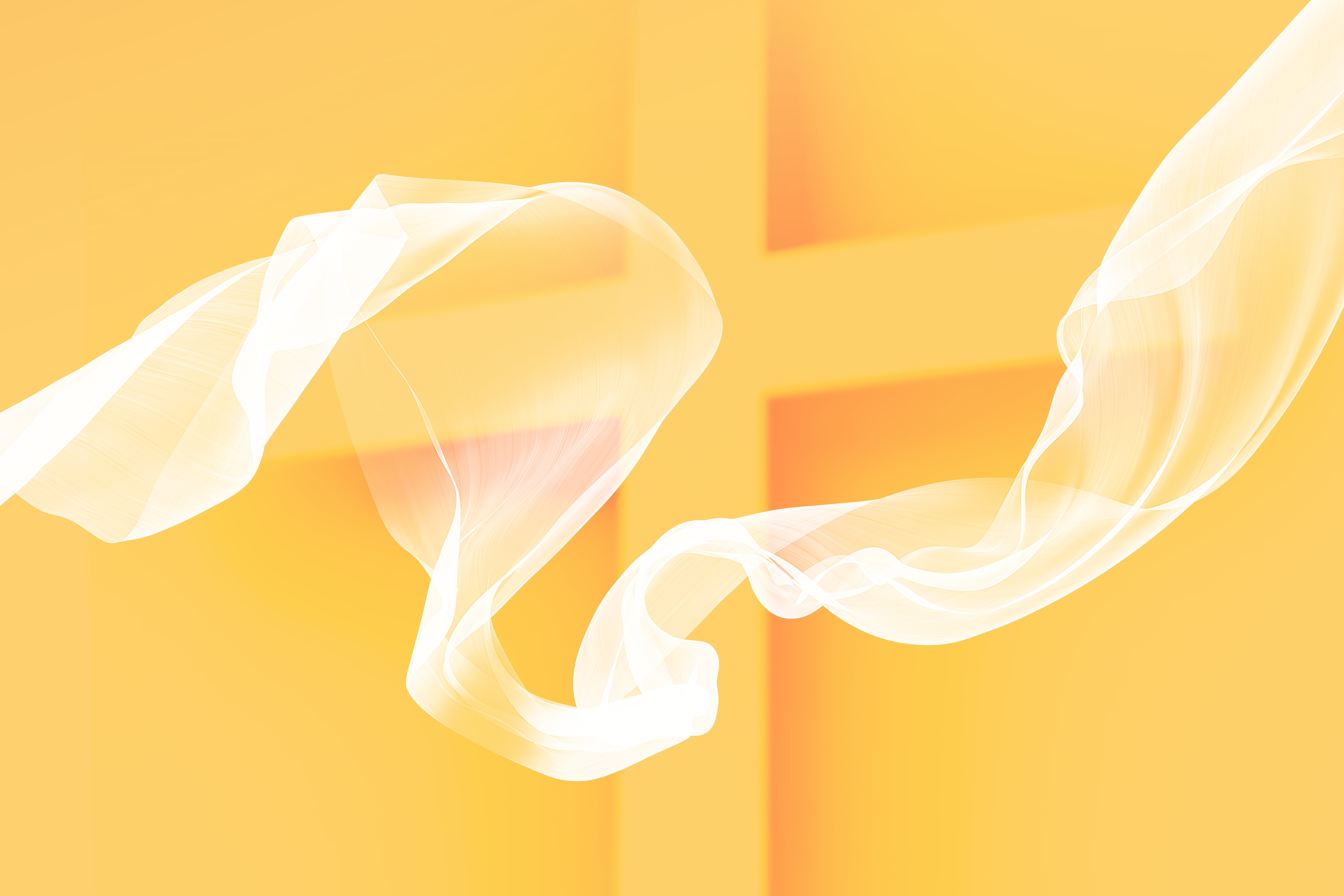Kunst gibt Anstöße
Das Interview mit Dr. Jürgen Emmert und Thomas K. Kopp führte Anja Legge.
 Zur Hauptabteilung „Bildung und Kultur“ gehört auch das weite Feld der Kunst. Im Würzburger „Museum am Dom“ (MAD) wurde dieses Feld mit dem Einzug der „Theaterhalle am Dom“ nun um noch eine Komponente erweitert. Warum Museum und Theater künftig miteinander kooperieren, wie die Zusammenarbeit konkret aussehen soll und was „Normal“-BesucherInnen sowie SchülerInnen davon haben, erläutern Museumschef Dr. Jürgen Emmert (JE) und Intendant und Choreograph Thomas K. Kopp (TK) im Interview.
Zur Hauptabteilung „Bildung und Kultur“ gehört auch das weite Feld der Kunst. Im Würzburger „Museum am Dom“ (MAD) wurde dieses Feld mit dem Einzug der „Theaterhalle am Dom“ nun um noch eine Komponente erweitert. Warum Museum und Theater künftig miteinander kooperieren, wie die Zusammenarbeit konkret aussehen soll und was „Normal“-BesucherInnen sowie SchülerInnen davon haben, erläutern Museumschef Dr. Jürgen Emmert (JE) und Intendant und Choreograph Thomas K. Kopp (TK) im Interview.
Wie passt die Kunst in den Bereich der Bildung und Pädagogik?
JE: Das lässt sich gut anhand der Namensgebung für die Hauptabteilung erklären. Bewusst haben wir dort den Begriff „Kultur“ gewählt. „Kunst“ wäre etwas eng geführt auf bildende Kunst gewesen. „Kultur“ dagegen ist weiter gefasst und schließt beispielsweise auch Angebote der Domschule mit ein. Und wenn ich heute zu Thomas Kopp rüberschaue, weiß ich erst recht, dass der offenere Begriff die richtige Entscheidung war.
Wo kann die Religions-Pädagogik von der Kunst profitieren?
JE: Etwas plakativ formuliert sind Theologen immer auf Sinnsuche. Kunst dagegen ist etwas Freies, Offenes. Das heißt: Als Betrachter werde ich mit einem Objekt, einer Performance, einer Videoinstallation, einer Architektur konfrontiert, und es tauchen spontane Emotionen auf. Diese Emotionen, das Herz können Kunst und Kultur in die Theologie einbringen.
Und umgekehrt?
JE: Natürlich ist nicht alles nur Emotion und Gefühl. Auch der intellektuelle Zugang hat seine Berechtigung. Manche Dinge muss ich einfach wissen, um zu verstehen. Als Museum der Diözese haben wir ja auch den Auftrag, Bildthemen sichtbar zu machen. Nur so kann der Mensch die Kultur, in der er lebt, ja verstehen. Das betrifft übrigens nicht nur Menschen aus anderen Herkunftsländern, sondern gerade unsere 15- und 16-Jährigen, die kaum mehr kirchlich sozialisiert sind.
Das MAD hat in diesem Jahr ein neues Gesicht bekommen. Warum war eine Neukonzeption nötig?
JE: Man sagt, ein Museum hat etwa eine Halbwertszeit von rund zehn Jahren. Das Museum am Dom wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Themen wie Inklusion, Gender, Klima – danach hat damals niemand gefragt. Die Gesellschaft verändert sich. Und auch die Besucher wandeln sich: Heute kommen keine Seniorengruppen mit dem Pfarrer mehr. Und bei den jungen Leuten fehlt oft einfach das Grundwissen.
TK: Das betrifft Theater und Tanz ja ganz genauso. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um die Menschen zu erreichen. „Kunst um der Kunst willen“ reicht einfach nicht. Vor allem Bühnenkunst funktioniert nur, wenn zwei dabei sind: Akteur und Zuschauer. Und die sollten miteinander in Interaktion treten.
Klingt logisch, aber wie lässt sich das umsetzen?
TK: Indem ich beide sehr nah aneinander ranlasse. Wir haben keine Guckkastenbühne, also hier die hehren Künstler und dort die im Dunklen sitzenden Zuschauer. Nein, die Zuschauer sind über Sprache, Video, Bühnenlicht, Inhalt am Geschehen beteiligt, es entstehen Bilder, Emotionen, ein Gesamtpaket, an dem der Betrachter automatisch mitwirkt. Diese Nähe ist nicht für jeden leicht zu ertragen. Aber sie ist wichtig.
JE: Bei uns ist das nicht anders. Deshalb gehen wir in unserer Neukonzeption auch weg vom klassischen Rundgang mit Bild und Beschriftung.
Sondern? Wo geht es mit der Neukonzeption hin?

JE: Die Gegenüberstellung von Alt und Neu bleibt natürlich weiter unser Proprium, unsere DNA. Neu ist, dass wir mit Farben Raumeindrücke und Inszenierungen schaffen. Wir haben die Werke kontextualisiert und Themenbereiche wie „Mensch“, „Natur“, „Mutter“, „Sohn“ geschaffen. Der Sammlungsschwerpunkt „Ostdeutsche Künstler“ wurde als Gruppe zusammengenommen, in der Vitrine Friedrich Press lässt sich die Entwicklung eines Künstlers ablesen, der „fränkische Hausheilige“ Tilman Riemenschneider ist neu erlebbar. Neu sind auch die „Character Walks“, also Rundgänge unter bestimmten Gesichtspunkten wie „Techniken der Kunst“ oder „Ikonographie“. Jeder geht den Rundgang, nach dem ihm gerade ist. Und dem Freigeist lassen wir die Freiheit, sich seinen Rundgang selbst zusammenzustellen. In diesem Sinne ist auch unsere neue Unterzeile „Think what you like“ zu verstehen.
Im Januar ist der von Ihnen gegründete „tanzSpeicher“ ins Untergeschoss des MAD gezogen. Was hat Sie als nicht-binnenkirchlicher Kulturschaffender dazu bewogen, in ein Museum der Diözese einzuziehen?
TK: Im Grunde hat Corona den Prozess, den ich schon seit Jahren mit mir herumtrage, nur beschleunigt. Als Künstler waren wir bisher ja von unserer Systemrelevanz überzeugt. Und dann ist auf einmal eineinhalb Jahre Schluss, die Theater sind zu, das war‘s. Aber ist es nicht gerade die Existenzberechtigung zeitgenössischer Kunst, sich beständig zu hinterfragen und neu zu erfinden? Nach 18 Jahren im Kulturspeicher haben wir alles gemacht, was machbar war. Da brauchte es einfach eine Weiterentwicklung. Dazu kam der Wunsch, sich mehr in die Stadtgesellschaft hineinzubegeben. Und natürlich die Vernetzung mit anderen Künstlern. Dass wir bei der Suche nach Kooperationspartnern schließlich hier gelandet sind, hat auch damit zu tun, dass wir bereits 2018 mit den Tanzminiaturen zu Cäsar W. Radetzky sehr gute Erfahrungen mit dem MAD gemacht haben.
JE: Für uns ist das nicht anders. Es geht ja nicht nur um Geld, sondern um eine Belebung und optimale Nutzung des Hauses. Leerstand ist keine Option. Uns war es wichtig, eine Lebendigkeit im Museum zu haben, die befruchtend wirkt. Auch die Kirche muss da aus der eigenen Blase rausgehen.
Aus dem an den Kulturspeicher angelehnten „tanzSpeicher“ ist die „Theaterhalle am Dom“ geworden. Wohin ist der Tanz verschwunden?
TK: Der Begriff „Halle“ spielt darauf an, dass wir hier kein festes, unveränderbares Theater installiert haben, sondern einen flexiblen Raum, der jederzeit verändert werden kann. Der ist dann auch für andere Kulturschaffende nutzbar, für ein Konzert, eine Lesung, einen Vortrag oder eine Wechselausstellung während der Theaterferien. Diese generelle Offenheit drückt der Begriff „Theater“ aus.
Wie soll die Kooperation konkret aussehen?
TK: Zunächst einmal geht es darum, zwei Institutionen zusammen zu bringen, die dennoch autark bleiben. Die Theaterhalle hat ja keinen Vertrag mit dem Bistum, sondern einen Untermietvertrag mit dem Museum am Dom. Trotzdem wollen wir Synergien schaffen, uns gegenseitig bereichern, Neues entdecken. Tanz ist für mich an der Schnittstelle zwischen bildender und darstellender Kunst. Und das ist der Reiz an der Sache!
JE: Mit dem Tanz kommt eine weitere Kunstkomponente ins Museum am Dom. Zur Stille und Statik kommen jetzt Geräusch, Bewegung, Lebendigkeit, Körperlichkeit. Mit Tanz und Bewegung können wir ein Kunstwerk ganz neu beleuchten. Bei der Finissage der Paul-Diestel-Ausstellung im März war zum Beispiel eine Tanzminiatur zu sehen.

TK: Im ersten halben Jahr hatten wir Repertoirestücke im Programm, die an Atmosphäre, Bühnenlicht und Sound des neuen Raumes adaptiert waren. Jeder Raum macht ja etwas mit mir, dem Zuschauer, dem Stück, seiner Aussage. Um dann auch für die Leute draußen sichtbar zu werden, wollen wir im Sommer auf dem Kiliansplatz kleine Tanzminiaturen oder eine Performance im Eingangsbereich aufblitzen lassen. Und natürlich freuen wir uns auf Impulse aus der bildenden Kunst. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, ein riesiges Bild oder eine Skulptur in die Bühne zu hängen und tänzerisch zu beleuchten.
JE: Das gesamte Domquartier ist aktuell ja ziemlich in Bewegung. Von daher ist künftig auch etwas mehr Sichtbarkeit wünschenswert. Vielleicht geht sogar ein Café auf dem Kiliansplatz?
Was sollen Museums- und Theater-BesucherInnen denn im besten Fall am Ende mitnehmen?
TK: Ich wünsche mir ein neues Bewusstsein: Kunst darf nichts Besonderes mehr sein, sondern so normal wie die Luft zum Atmen.
JE: Kultur muss zum Lebensmittel werden, Kunst ersetzt den Therapeutenbesuch, muntert mich auf, weitet den Blick. Aber auch: Kunst gibt Anstöße und setzt Duftmarken in der Gesellschaft – für Freiheit, Demokratie, die Weite des Blickes. Und das tut auch Kirche gut: Dinge anschauen, den Blick weiten, offen sein.
Das macht das Museum vermutlich auch für Religionslehrkräfte und Schulklassen interessant…
JE: Ja. Im Sinne von: Schaut hin, Kunst gibt Euch Anstöße, Kunst macht eine Gesellschaft frei!
TK: Das Problem ist, dass 15-Jährige gar nicht auf die Idee kommen, von selbst ins Theater oder Museum zu gehen. Die Herausforderung ist für mich deshalb, die Besuche mit der Schule so schmackhaft zu machen, dass die Jugendlichen von selbst wiederkommen.
Werfen Sie einen Blick in das Jahr 2032!
JE: Ich bin kein Prophet. Aber ich denke, wir sollten uns vor allem die Offenheit bewahren. Am Puls dranbleiben.
TK: Schwer zu sagen. Aber immer wieder nach vorne gucken, neugierig bleiben, neue Blickwinkel einnehmen, mit allen Generationen im Gespräch zu bleiben, das ist entscheidend.